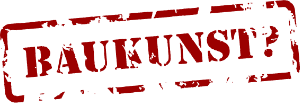Strom weg, Gesellschaft bloß
Der Berliner Blackout und die Architektur der Verwundbarkeit
Am frühen Morgen des 3. Januar 2026 erlosch in weiten Teilen des Berliner Südwestens das Licht. Nicht wegen eines technischen Defekts, nicht wegen Schneesturm oder Altersschwäche der Netze, sondern wegen eines gezielten Brandanschlags auf eine Kabelbrücke über den Teltowkanal beim Heizkraftwerk Lichterfelde. Fünf Hochspannungs- und zehn Mittelspannungskabel wurden beschädigt. Rund 45.400 Haushalte und 2.200 Betriebe in Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde blieben tagelang ohne Strom und Heizung, mitten im tiefsten Winter. Es war der längste Stromausfall der Stadt seit 1945.
Die linksextreme Vulkangruppe bekannte sich zu dem Anschlag. Doch wer die Bombe zündete, erklärt noch nicht, warum sie so verheerend wirkte. Diese Frage ist eine architektonische, eine stadtplanerische und zutiefst gesellschaftliche.
Eine Stadt auf einem Bein
Moderne Großstädte sind Hochleistungssysteme mit erschreckend dünner Redundanz. Das Berliner Stromnetz, wie das der meisten deutschen Großstädte, ist historisch gewachsen, nicht für hybride Angriffe konzipiert, sondern für den Normalbetrieb optimiert. Einzelne Knotenpunkte tragen Lasten, die für ganze Stadtteile existenziell sind. Fachleute nennen das single points of failure: eine einzige Kabelbrücke, eine einzige Verbindungsleitung, ein einziges Unterwerk, und Zehntausende sitzen im Dunkeln.
Schon die Flutkatastrophe im Ahrtal hat gezeigt, dass sämtliche Kapazitäten für eine Region mit 42.000 Betroffenen eingesetzt wurden. Die Berliner Hauptstadtregion zählt vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Ein längerer, flächendeckender Ausfall wäre logistisch kaum beherrschbar.
Die Schwachstellen liegen nicht nur in der Energieinfrastruktur. Heizungsanlagen, Wasserdruckpumpen in Hochhäusern, Mobilfunktürme, Klinik-IT, Ampelanlagen, Eisenbahnstellwerke, alles hängt am Strom. Fällt er weg, bricht eine Kaskade zusammen. Im Januar 2026 waren zeitweise 39 Mobilfunkstandorte eines einzigen Anbieters ausgefallen. Der Notruf war stundenlang überlastet, nicht mit echten Notfällen, sondern mit Anrufen besorgter Bürgerinnen und Bürger ohne Strom.
Wer wohnt, wer friert, wer geht
Der Blackout traf Quartiere mit sehr unterschiedlicher sozialer Zusammensetzung. Nikolassee, Wannsee, Schlachtensee sind die Villenviertel des gutbürgerlichen Berliner Westens. Aber auch dicht besiedelte Mehrfamilienhaussiedlungen wie die Thermometersiedlung in Lichterfelde gehörten zum betroffenen Gebiet. Hier zeigt sich eine soziale Asymmetrie, die Stadtplaner und Architektinnen kennen, die aber selten so scharf hervortritt wie in einer Krise.
Wer ein eigenes Haus, ein Auto, Verwandte auf dem Land oder genug Mittel für ein Hotelzimmer hat, übersteht einen mehrtägigen Stromausfall mit Unannehmlichkeiten. Wer in einem Hochhaus im 14. Stock lebt, auf einen Aufzug angewiesen ist, in einer Pflegeeinrichtung wohnt oder keine sozialen Netzwerke besitzt, steht vor einer anderen Situation. Der Bezirk richtete Notunterkünfte ein, Feldbetten in Sportzentren, Wärmestuben, Ladestationen für Handys. Das ist Krisenmanagement im Geiste der Nachkriegszeit: improvisiert, würdig, aber nicht konzipiert für eine Stadt des 21. Jahrhunderts.
Ferdinand Gehringer, Ko-Autor eines Buchs über ‚Deutschland im Ernstfall‘, benennt das strukturelle Versagen: Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser verfügen zwar über Generatoren, doch die Kapazitäten reichen selten für mehrtägige Ausfälle. In Skandinavien ist es selbstverständlich, dass Betriebe Notstromaggregate vorhalten. In Deutschland ist das die Ausnahme.
Das Krisenmanagement als Spiegel
Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner erklärte öffentlich, er habe den Tag des Anschlags koordinierend in seinem Büro verbracht. Später stellte sich heraus, dass er zeitweise Tennis gespielt hatte, gemeinsam mit Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, seiner Lebensgefährtin. Das Bild wurde zur Metapher.
Nicht weil Tennis ein Vergehen wäre. Sondern weil es die Frage aufwirft, ob die politische Führung einer Großstadt Protokolle und Reflexe für solche Lagen überhaupt besitzt. Die Großschadenslage wurde erst einen Tag nach dem Anschlag ausgerufen, als das volle Ausmaß bereits bekannt war. Die Bundeswehr wurde erst nach einem Tag der Zurückhaltung angefordert. Die 45 vom Senat angekündigten Katastrophenschutz-Leuchttürme, Anlaufstellen für die Bevölkerung in Krisen, waren zum Zeitpunkt des Blackouts zu nur knapp einem Drittel einsatzbereit, wie der Berliner Rechnungshof kurz zuvor bemängelt hatte.
Diese Lücken sind keine Einzelversagen. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Fehlpriorisierung in der Stadtplanung. Der Begriff der Friedensdividende lässt sich auf viele Bereiche ausdehnen: nicht nur auf Bundeswehr und Straßenmeisterei, sondern auch auf Katastrophenschutz, Redundanz im Versorgungsnetz und die schlichte Frage, ob eine Stadt Notfallpläne hat, die auch funktionieren.
Resilienz ist keine Kostenstelle, sondern Bauaufgabe
Aus architektonischer Sicht stellt sich der Berliner Blackout als Planungsversagen dar, das sich über Jahrzehnte aufgeschichtet hat. Kritische Infrastruktur, Stromkabelbrücken, Unterwerke, Wasserwerke, Knotenpunkte des Mobilfunknetzes, ist in der Stadtplanung vielfach unterbelichtet geblieben. Sie verschwindet im Untergrund, wird hinter Zäunen versteckt oder in Industriezonen abgeschoben. Unsichtbarkeit ist ihr Schicksal und ihre Schwäche.
Eine resilientere Stadtstruktur würde kritische Infrastruktur nicht verstecken, sondern redundant anlegen: Leitungen unterirdisch, mehrfach und aus verschiedenen Richtungen. Knotenpunkte nicht als singuläre Punkte, sondern als verteilte Systeme. Dazu bräuchte es verstärkte physische Sicherung, Zaunanlagen, Zugangskontrollen, Überwachung. Das klingt unattraktiv. Es ist aber Stadtbau.
Das seit Langem diskutierte KRITIS-Dachgesetz, das Betreiber kritischer Infrastruktur zu Resilienzinvestitionen verpflichtet, war zum Zeitpunkt des Anschlags noch nicht vom Bundestag verabschiedet. Es ist ein symptomatisches Detail: Auch der Rechtsrahmen war nicht resilient genug. Nach dem Berliner Blackout soll das Gesetz beschleunigt kommen. Manche Lehren zahlt man teuer.
Freiheit und Sicherheit: Keine falschen Gegensätze
Es wäre verleiterisch, aus dem Berliner Blackout zu schließen, Sicherheit und Freiheit stünden in einem grundlegenden Spannungsverhältnis. Mehr Überwachung, mehr Abschottung, mehr Kontrolle als Reaktion auf hybride Angriffe liegt nahe. Sie führt aber in die Irre.
Was Berlin wirklich braucht, sind keine Überwachungskameras an jeder Kabelbrücke. Gebraucht werden kluge Stadtplanung, verteilte Strukturen statt zentralisierter Systeme, robuste statt effizienzmaximierte Infrastruktur, soziale Resilienz statt bloßer technischer Absicherung. Dazu gehört auch, dass Bevölkerungsgruppen sich in Krisen gegenseitig stützen können, was Gemeinschaftsräume, funktionierende Nachbarschaften und soziale Infrastrukturen voraussetzt. Ein Quartier, dessen Bewohnerinnen und Bewohner sich kennen, ist resilienter als eine Siedlung anonymer Mieterinnen und Mieter.
Eine Studie der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau von 2025 ergab: Mehr als die Hälfte der Befragten hat sich bislang nicht mit Notfallvorsorge beschäftigt. Ein Drittel hält persönliche Katastrophenbetroffenheit für unwahrscheinlich. Das ist kein Versagen der Bevölkerung, es ist ein Versagen der Kommunikation, Planung und politischen Bildung.
Der Berliner Blackout ist kein Ausnahmefall. Er ist ein Vorgeschmack. Drei vergleichbare Anschläge auf Berliner Strominfrastruktur in zwei Jahren, Adlershof im September 2025, Lichterfelde im Januar 2026, dazu der Anschlag auf das Tesla-Werk in Grünheide 2024, zeigen ein Muster. Die Reaktion darauf darf nicht nur eine sicherheitspolitische sein. Sie muss eine stadtbauliche sein.

Berliner Blackout 2026: Was der Stromausfall über die Verwundbarkeit unserer Städte verrät

Geschäftsklima Architekturbüros 2026: ifo Index auf 17 Jahres Tief, Nachfrage bricht ein, KI als Hoffnungsschimmer