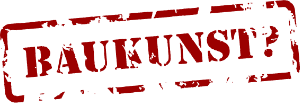Expo 2035 Berlin: Stadt statt Spektakel
Die Initiative Global Goals Berlin präsentiert die Expo 2035 als eine Art architektonisches Gegenprogramm zu traditionellen Weltausstellungen. Statt einer Insel im Stadtraum soll die gesamte Metropole zur Bühne werden: Kiezlabore verteilt in allen Bezirken, urbane Satelliten auf Tempelhof und Tegel, ein thematisches Netzwerk statt pyramidaler Struktur. Das Konzeptteam unter Beteiligung renommierter Architekturbüros wie Graft, Langhof und Lava hat dabei eine Vision entwickelt, die Berlin als Stadt ohne klares Zentrum auffasst und diese Dezentralität zum Markenzeichen macht.
Faszinierend ist die konzeptionelle Idee. Berlin mit seinen vielen Zentren, seinen fragmentierten Räumen zwischen Brachflächen und Innovation, wird zum Vorbild einer polyzentrischen Ausstellung erklärt. Die modulare, reversible Architektur soll nach 2035 in neue Nutzungen übergehen: Bildungsorte, Werkstätten, Nachbarschaftshäuser. Das ist das Versprechen einer nachhaltigen Weltausstellung, nicht die Plättchenarchitektur früherer Expos, sondern ein Transformationsprozess, der die Stadt dauerhaft verändert.
Doch genau hier wird es kritisch.
Das Hannover-Problem: Wenn Visionen auf Wirklichkeit treffen
Die Expo 2000 in Hannover hält für viele Architektur- und Kulturkritiker den Status einer Warnung. 40 Millionen Besucherinnen und Besucher wurden prognostiziert, nur 18,1 Millionen kamen. Die Kosten betrugen 3,5 Milliarden D-Mark, hinzu kamen etwa 7,7 Milliarden Euro Infrastrukturinvestitionen. Für Steuerzahler blieb ein Minus von rund 1,1 Milliarden D-Mark. Die hohen Eintrittspreise (69 D-Mark, heute etwa 55 Euro) hemmten die Besucherzahlen. Ein unzureichendes Marketing-Konzept hemmte die Vermittlung der inhaltlichen Vision.
Der niederländische Pavillon verrottete für Jahre mit Stacheldraht-Zäunen und Warnschild. Viele Pavillons wurden zu Relikte eines Festivals, das schneller verblasste, als seine Initiatoren sich erhofften. Der Erfolg der Nachnutzung wird mit 85 Prozent behauptet, doch lange Zeiten der Leerstände und fehlender Investment zeigen, dass reversible Architektur nicht automatisch reversible Nutzungsfähigkeit garantiert.
Das PwC-Gutachten für Berlin bescheinigt der Expo 2035 ein Umsatzpotential von 2,1 Milliarden Euro und einen gesamtwirtschaftlichen Wachstumseffekt im zweistelligen Milliardenbereich. Solche Prognosen erinnern handlich an die Hannover-Szenarien. In Berlin wird Besonnenheit verlangt: nicht Euphorie über potentielle Milliarden, sondern kritisches Hinterfragen der realistischen Nachnutzungskonzepte.
Dezentralität als Risiko: Die Gouvernance-Frage
Ein dezentrales Konzept bringt Koordinationsprobleme mit sich, die bei klassischen Expos durch einheitliche Organisationen gelöst werden. Wie synchronisiert man internationale Gelände in Tegel und Tempelhof? Wie garantiert man Qualitätsstandards in 100 Kiezlaboren gleichzeitig? Wie verhindert man, dass einige Standorte zu Tagesausflugzielen herabsinken, während andere prekär bleiben?
Die Initiative spricht vom Münchner Ansatz, von schnellerer Bürokratie durch Expomedium. Das ist ein begründeter Optimismus. Berlins Planungsapparat hält jedoch oft Märkisches Schlendrian parat. Die Sicherung von Konsistenz über Dezentralität hinweg ist in dieser Hinsicht keine architektonische, sondern eine politische Aufgabe, und dort zeigt sich Berlin häufig schwächer als Hannover damals.
Nachhaltigkeit als Marketing-Instrument?
Das zentrale Versprechen lautet: Die Expo 2035 macht Berlin zur ersten Weltausstellung der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsziele der UN sollen Leitlinie sein. Photovoltaik-Hüllen, adaptive Fassaden, begrünte Dachlandschaften, digitale Steuerungssysteme werden in den Visualisierungen propagiert. Das ist nicht falsch, es ist aber auch nicht neu. Jede moderne Expo läuft unter dieser Fahne.
Das Problem liegt in der Transformation von Versprechen zu Realität. Die moderaten Visualisierungen zeigen smarte Architektur. Die Realität wird zeigen, ob sich Kiezlabore für urbane Landwirtschaft nach drei Jahrzehnten umgestalten lassen oder ob sie zu sozialen Ruinen der Unter- und Mittelschicht verkommen. Die reversible Architektur ist Material. Die reversible Ökonomie, ob ein Modelllabor für Energienetze 2040 noch relevant ist, ist eine andere Frage.
Zum Tegel-Effekt: Großgelände und ihre Lasten
Tempelhof und Tegel sind paradigmatische Berliner Räume: Orte von erodierten Industrietraditionen, ehemaligen Flughafen-Funktionen, von Parkflächen und Kulturpiraterie, von Squatter-Szenen und Gentrificationsdruck. Sie als Expo-Satelliten zu nutzen, ist zwar plausibel. Es wirft aber auch Fragen zur Kapitalisierung dieser Orte auf. Werden die geplanten Nebenzentren Katalysatoren für nachhaltige Nachnutzung oder Trojanische Pferde für spekulative Stadtentwicklung?
Hier unterscheidet sich die Berliner Realität signifikant von norddeutschen Konzepten. Berlin ist teuer geworden, verdrängt rasch, und die Abgrenzung zwischen Participatory Design und Investment-Aktivierung verwischt sich im Laufe von zehn Jahren schnell.
Finanzierung: Wer zahlt die Kosten?
Die Expo-Initiative spricht von 2,5 Millionen Euro Startkapital bis Jahresende, kombiniert mit öffentlichen Mitteln, privaten Partnerschaften und internationalen Kooperationen. Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat ein größeres Sequencing vorgeschlagen: eine Internationale Bauausstellung 2034, die Expo 2035, das 800. Stadtjubiläum 2037, eine mögliche Olympia-Bewerbung 2040. Das wirkt koordiniert, ambitioniert, und teuer.
Realistische Kostenrechnungen sind nicht veröffentlicht. Wenn Berlin in zehn Jahren rund 7,7 bis 10 Milliarden Euro in dezentralisierte Expo-Infrastruktur investiert, bedeutet das Prioritäten, die anderen Bereichen fehlen: Schulbau, Wohnungsneubau, Verkehrsverlagerung. Die Finanzierungsfrage ist nicht architektonisch, sie ist strategisch.
Chancen trotz Herausforderungen
Nicht alles ist Kritik. Das Konzept hat Qualitäten, die traditionelle Expos nicht haben:
Das dezentralisierte Modell kann Stadtquartiere stärken, ohne Enklaven zu schaffen. Die Planung über zehn Jahre erlaubt Experimentieren und Kalibrierung. Die Sichtbarmachung von Nachhaltigkeit als Transformationsprozess statt als abgeschlossene Show ist konzeptionell anspruchsvoller als frühere Weltausstellungen. Die Kiez-Labs könnten als dauerhafte Stadtlaboratorien fortbestehen.
Besonders faszinierend ist die kulturelle Dimension: Berlin als Stadt ohne klares Zentrum nutzt die Dezentralität nicht als Schwachstelle, sondern als Identität. Das Konzept hält Potential, neue Standards für zukünftige Weltausstellungen zu setzen, und damit Vorbild zu sein für dezentralisierte, partizipative Urbane Transformation.
Die große Frage
Die Expo 2035 wird sich letztlich an einer einzigen Frage entscheiden: Wird sie ein Beschleuniger für eine echte urbane Nachhaltigkeitstransformation sein, oder ein Etikett für spekulative Infrastruktur-Investitionen?
Berlin entscheidet 2026 über die Bewerbung. Der Abstimmungsprozess der BIE-Mitgliedstaaten erfolgt wahrscheinlich 2027. Bis dahin gibt es Zeit, aus Hannover zu lernen, realistische Finanzierungsmodelle zu entwickeln und die Dezentralität nicht nur als architektonisches Konzept, sondern als gelebte Gouvernance-Struktur auszuarbeiten.
Das Konzept ist mutig. Das ist die Stärke und das Risiko zugleich.

Ark Nova in Luzern: Wenn die Architektur atmet und die Musik schwebt

Hausgeschichte erforschen: So entdecken Sie die Vergangenheit einer Immobilie Schritt für Schritt