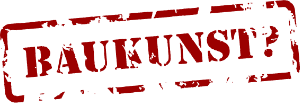Institutionalisierte Ambition: Wie Frankfurt seinen Theaterbau organisiert
Es gibt Entscheidungen, die klingen nach Verwaltungsroutine und sind doch alles andere als das. Der Beschluss des Frankfurter Magistrats, eine eigens zu gründende Bühnenbaugesellschaft mit dem Neubau von Oper und Schauspiel zu beauftragen, gehört zu dieser Kategorie. Auf 1,3 Milliarden Euro werden die Kosten offiziell geschätzt, die tatsächliche Summe dürfte erheblich höher liegen. Wer die Aufregung kennt, die Großbauprojekte der öffentlichen Hand regelmäßig begleitet, von Stuttgart 21 bis zur Hamburger Elbphilharmonie, der reibt sich die Augen: Frankfurt versucht es diesmal anders.
Ein Gebäude am Ende seiner Kräfte
Die Theaterdoppelanlage am Willy-Brandt-Platz ist ein Dokument der Nachkriegsmoderne, das sich selbst überlebt hat. Von 1959 bis 1963 nach Plänen des Architekten Otto Apel und dem Büro ABB Architekten errichtet, sollte die Anlage zwei Institutionen unter einem Dach vereinen: Oper und Schauspiel, verbunden durch ein 120 Meter langes Glasfoyer, das der International Style der Zeit als Geste der Offenheit verstanden wissen wollte. Das Kunstwerk „Goldwolken“ des ungarischen Künstlers Zoltán Kemény im Foyer avancierte zum Wahrzeichen einer Stadtgesellschaft, die sich nach dem Krieg neu erfinden wollte. Heute steht die Anlage unter Denkmalschutz, und ausgerechnet dieser Schutz macht die Lage kompliziert.
Der Befund ist eindeutig: Die Obermaschinerie der Oper muss aus Sicherheitsgründen dringend repariert werden. 860.000 Euro sollen die Stadtverordneten außerplanmäßig freigeben, damit in der Spielpause im Sommer 2026 gearbeitet werden kann. Vorstellungen waren zuletzt nur noch in stark reduzierter Form möglich. Der Magistrat warnt unmissverständlich: Ohne Eingriff sei der weitere Betrieb gefährdet. Und gleichzeitig geht man davon aus, dass die Oper noch mindestens zehn Jahre im heutigen Haus spielen wird. Zehn Jahre also mit einem Gebäude, dessen Substanz man verwaltet, statt es zu gestalten.
Die GmbH als strategisches Instrument
Die Antwort der Stadt Frankfurt auf diese Situation ist bemerkenswert pragmatisch. Anstatt auf externe Projektsteuerer zu setzen oder den Bauablauf über die bestehende Stadtverwaltung abzuwickeln, gründet der Magistrat eine eigene Gesellschaft. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher in der beim Kulturdezernat angesiedelten Stabsstelle Städtische Bühnen tätig waren, wechseln in die neue Bühnenbaugesellschaft. Bis 2027 soll die Belegschaft auf 23 Personen wachsen. Der Magistrat argumentiert, eigenes Personal sei günstiger als externe Dienstleister und sichere zudem das über Jahre aufgebaute Fachwissen.
Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) begrüßt die Entscheidung: „Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für die nächste Stufe: die Institutionalisierung der Projektsteuerung und Bauherrenvertretung.“ Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Die Grünen) spricht von einer „strategischen Entscheidung für die Umsetzung eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte unserer Stadt“. Das klingt nach Überzeugung, ist aber auch Kommunikationsstrategie: Nach den Pleiten und Preissteigerungen anderer Kulturbauprojekte in Deutschland muss Frankfurt signalisieren, dass man die Kontrolle behält.
Einzige Gesellschafterin wird die Stadt Frankfurt sein. Die GmbH soll ein umfassendes Risikomanagement betreiben, zu dem ausdrücklich die Einhaltung von Kostenobergrenzen gehört. Allerdings: Diese Obergrenzen sind noch nicht festgelegt. Eine aktualisierte Kostenprognose wird derzeit erst erstellt. Das ist keine Kleinigkeit bei einem Projekt, das offiziell 1,3 Milliarden Euro kosten soll, in dem aber das Erbbaurecht für das Sparkassen-Grundstück an der Neuen Mainzer Straße noch nicht eingerechnet ist. Allein dieses Recht schlägt mit mehr als 200 Millionen Euro zu Buche.
Kulturmeile statt Doppelanlage: Die städtebauliche Vision
Was Frankfurt plant, ist mehr als ein Theaterbau. Es ist ein stadtplanerischer Eingriff von erheblicher Reichweite. Die favorisierte Variante, die sogenannte „Kulturmeile“, sieht vor, das neue Schauspiel auf dem Grundstück der Frankfurter Sparkasse an der Neuen Mainzer Straße 47 bis 53 zu errichten, das der Stadt im Erbbaurecht für 199 Jahre überlassen wird. Die Oper bleibt am Willy-Brandt-Platz, wo nach Abriss der bestehenden Anlage ein Neubau entstehen soll. Entlang der Neuen Mainzer Straße soll sich so eine Perlenkette kultureller Institutionen auffädeln: Jüdisches Museum, Oper Frankfurt, English Theatre, MMK Tower, Weltkulturen Museum und Alte Oper.
Die Architekten von gmp von Gerkan, Marg und Partner, die bereits die Machbarkeitsstudie erarbeitet haben, sprechen von einer einzigartigen städtebaulichen Chance: „Eine Reihung von Kulturinstitutionen entlang der Hochhäuser, das gibt es nirgends, aber wo sollte das möglich sein, wenn nicht in Frankfurt?“, erläutert gmp-Partner Stephan Schütz. Tatsächlich hat die Idee einer Kulturmeile im Bankenviertel einen provokanten Reiz. Dass Hochhäuser und Theater keine Widersprüche sein müssen, ist eine These, die Frankfurt unter Beweis stellen will.
Kritische Stimmen: Was beim Abriss verloren geht
Nicht alle teilen die Aufbruchsstimmung. Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) hat sich deutlich positioniert: Das bestehende Theatergebäude besitze architektonische Qualitäten, die durch einen vollständigen Abriss unwiederbringlich verloren gingen. Der Verband plädiert für eine Teilsanierung. Auch die Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus Frankfurt hat sich über Jahre für einen Wiederaufbau des historischen Seeling-Baus eingesetzt, der 1902 eröffnet und 1944 beschädigt worden war.
Aus architekturjournalistischer Sicht lohnt ein nüchterner Blick: Das Glasfoyer mit den Goldwolken von Zoltán Kemény ist zweifellos ein bedeutsames Zeugnis der Nachkriegsmoderne. Andererseits wäre es eine romantische Überfrachtung, einem Gebäude, das im laufenden Betrieb kaum noch sicher betrieben werden kann, allein aus Denkmalschutzgründen eine Zukunft zuzuschreiben, die es bautechnisch nicht mehr trägt. Die Frage lautet nicht, ob das Gebäude erhaltenswert ist, sondern was Erhalt konkret bedeutet und was er kostet.
Parallelfall neue Altstadt: Ein Frankfurter Modell?
Die Begleitung der Bühnenbaugesellschaft durch einen Sonderausschuss des Stadtparlaments ist keine Erfindung, sondern bewährte Frankfurter Praxis. Bei der Rekonstruktion der neuen Altstadt zwischen Dom und Römerberg, einem der meistdiskutierten und -besuchten Stadtbauprojekte der jüngeren deutschen Stadtplanung, gab es dieselbe Konstruktion. Die Parallele ist aufschlussreich: Frankfurt hat Erfahrung darin, komplexe Bauprojekte öffentlich zu begleiten und dabei trotzdem handlungsfähig zu bleiben.
Ob das gelingt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie schnell die Stadtverordnetenversammlung zustimmt. Letzte Gelegenheit vor der Kommunalwahl ist die Sitzung am 5. März 2026. Umstritten ist das Thema nicht, die Gründung einer GmbH ist bereits im Grundsatzbeschluss vom Dezember 2024 festgelegt. Die politische Einigkeit ist vorhanden. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt danach: mit dem Architektenwettbewerb, den Vergaben, dem Bau.
Kosten, Kontrolle, Komplexität
Das Projekt umfasst mehr als nur Oper und Schauspiel. Die neue GmbH steuert auch den Abbruch der bestehenden Theaterdoppelanlage und des Sparkassengebäudes, den Bau eines Übergangsquartiers an der Gutleutstraße sowie eines Lager- und Logistikzentrums auf einem noch zu findenden Grundstück. Die Komplexität ist erheblich, und der Magistrat räumt ein, dass die Stadtverwaltung diese Aufgaben allein nicht bewältigen könnte. Die Bündelung in einer professionellen Struktur ist daher keine Übervorsicht, sondern Realismus.
Was offen bleibt: Die aktualisierte Kostenprognose wird derzeit erst erstellt. Eine Kostenobergrenze, die die neue GmbH einhalten soll, gibt es noch nicht. Das ist ein strukturelles Problem. Risikomanagement ohne definierte Grenzen ist wie eine Brandschutzplanung ohne Brandlast. Hier ist die Stadt gefordert, rasch Klarheit zu schaffen, bevor die ersten Aufträge vergeben werden. Der internationale Wettbewerb für die Architektur steht noch aus. Wenn er ausgeschrieben wird, wird sich zeigen, wie ernst Frankfurt den Anspruch nimmt, Gebäude des 21. Jahrhunderts zu bauen: nachhaltig, energieeffizient, klimagerecht und architektonisch zukunftsweisend.
Ein Modell mit Modellcharakter?
Die Frage, ob das Frankfurter Modell der projektspezifischen GmbH auf andere Städte übertragbar ist, darf gestellt werden. Hamburg hat beim Konzerthaus-Bau leidvolle Erfahrungen mit komplexen Projektstrukturen gemacht. Berlin kämpft chronisch mit den Kosten seiner Kulturbauprojekte. München diskutiert seit Jahren über ein neues Konzerthaus. Dass eine Stadt eine eigene Baugesellschaft gründet, ihr klare Aufgaben überträgt und sie durch ein parlamentarisches Gremium begleiten lässt, ist kein Patentrezept, aber ein nachvollziehbarer Versuch, aus den Fehlern anderer zu lernen.
Was Frankfurt in den nächsten Jahren zeigen muss: dass eine GmbH nicht nur schneller, sondern auch klüger baut als eine Behörde. Dass Budgets eingehalten werden, nicht weil man billig baut, sondern weil man gut plant. Und dass die Kulturmeile am Ende tatsächlich das wird, was sie verspricht: ein Stadtraum, der Frankfurts Skyline mit einer neuen kulturellen Identität verbindet. Das Milliardenprojekt wird die Stadt prägen. Die Frage ist nur, wie.

Kirchlicher Immobilienverkauf: Wer übernimmt die sozialen Räume und ist die Kirchensteuer noch zeitgemäß?

Berliner Blackout 2026: Was der Stromausfall über die Verwundbarkeit unserer Städte verrät