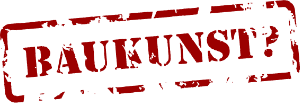Ein Theater als Auftakt zu einem Abenteuer
Der Rhein-Main-Raum gilt als eine der dichtesten Metropolregionen Deutschlands. Die Bodenpreise klettern kontinuierlich nach oben, der Wohnungsmangel ist strukturell, und für Immobilienentwicklerinnen und -entwickler winken fettleibige Margen. Diese vermeintlich idealen Bedingungen hätten auch für Mario von Heesen, einen erfahrenen Investor, das Signalgrün setzen sollen – doch die Geschichte des geplanten „Theaterquartiers“ in Niedernhausen zeigt: Im deutschen Verwaltungsföderalismus gibt es keine Gewaltverträge zwischen privater Gewinnerwartung und kommunaler Gestaltungsverantwortung.
Heesen erwarb das Areal mit dem ehemaligen Rhein-Main-Theater 2021 von der Feria Bau KG. Das Theater selbst war eine kurze Episode – 1995 mit großen Erwartungen eröffnet, nach knapp drei Jahren und 992 Vorstellungen wieder geschlossen. Seitdem stand das Gebäude weitgehend leer, durchbrochen nur von Zwischennutzungen und gescheiterten Revitalisierungsversuchen. Ein klassisches Brownfield-Szenario also: eine Fläche von 28.500 Quadratmetern, Tiefgarage bereits vorhanden, infrastrukturelle Voraussetzungen gegeben. Für den Entwickler schien dies eine Chance ohne Häkchen zu sein.
Das kommunale Gestaltungsrecht als Stolperstein
Heesen präsentierte eine ehrgeizige Idee: das „Theaterquartier“ mit bis zu 400 Wohnungen, ergänzt durch Einzelhandel, Gastronomie und eine Kita. Eine Reaktivierung des stillgelegten Bahnhaltepunkts war vorgesehen, eine Park-and-Ride-Fläche sollte die Verkehrsbilanz verbessern. Auf dem Papier ein zukunftskonformes, nachhaltiges Konzept – das Symbol für die New-Urbanity-Rhetorik der 2020er Jahre.
Nur: Der damalige Bürgermeister Joachim Reimann (CDU) warnte realistisch vor Planungszeiten von vier bis sechs Jahren. Diese Schätzung erwies sich nicht als pessimistisch, sondern als optimistisch. Denn die Gemeindevertretung Niedernhausens stellte Anforderungen, die nicht im unternehmerischen Geschäftsmodell des Investors vorgesehen waren. Die Kommune pochte auf eine „Flächenübertragung“: Heesen sollte mindestens die Hälfte des Grundstücks kostenlos an die Gemeinde abtreten, um in Partnerschaft mit der Kommunalen Wohnungsbau gemeindeeigene, preisgedämpfte Wohnungen zu schaffen.
Dies ist keine wilde Forderung, sondern Ausdruck einer langjährigen Debatte über Bodenordnung und Gemeinwohl. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass eine Gemeinde, die aus eigenem Planungsrecht ein Freizeitgelände in kostbares Bauland umwandelt, an diesem Mehrwert partizipieren darf. Das ist die deutsche Planungstradition: Gemeinden werden nicht als bloße Genehmigungsbehörden verstanden, sondern als aktive Gestaltungsakteure mit eigenem Anspruch.
Das Problem der asymmetrischen Machtverhältnisse
Doch an dieser Stelle hätte das System funktionieren können, wenn nicht die Kommunikation selbst gescheitert wäre. Die Forderungen der Gemeinde gingen über die Flächenübertragung hinaus: Heesen sollte für zehn Jahre ein Quartiersmanagement finanzieren und den Betrieb von Einkaufsläden, Gaststätten und Kita garantieren. Die Gemeinde, vertreten durch Bürgermeisterin Lucie Maier-Frutig (CDU), argumentierte, dass ohne diese Garantien der „Mehrwert für die Gemeinde“ nicht realisierbar sei.
Heesen hingegen sah sich in eine unmögliche Position geraten. Seine Planung, wie er formulierte, „löste sich in Luft auf“. Der Investor versuchte Alternativmodelle: einen finanziellen Ausgleich für die Wertsteigerung oder die Reservierung eines Kontingents von Wohnungen für Menschen mit kleinen Einkommen. Beide Vorschläge lehnte die Gemeinde ab – auf Rat einer Fachanwältin aus rechtlichen Gründen.
Das ist der kritische Punkt: Heesen berief sich darauf, dass solche Modelle in anderen Kommunen erfolgreich praktiziert werden. Die Gemeinde dagegen bestand darauf, dass genau diese Modelle rechtlich fragwürdig seien. Wer hier recht hat, vermag von außen schwer zu beurteilen. Was sich aber deutlich erkennen lässt, ist eine Differenz in den Planungskulturen, vielleicht sogar ein Generationenkonflikt zwischen zwei Konzeptionen von städtebaulicher Verantwortung.
Die unbequeme Wahrheit über Landwerte und Gemeinwohl
Bürgermeisterin Maier-Frutig formulierte es prägnant: „Letztlich wäre allein die Renditeerwartung des Eigentümers entscheidend. Das kann nicht Sinn und Zweck zukunftsfähiger städtebaulicher Planungen sein.“ Dieser Satz verdichtet den Konflikt. Er drückt aus, dass die Gemeinde sich einer Logik widersetzt, in der der Boden zum reinen Rohstoff für Kapitalverwertung wird.
Gleichzeitig offenbarte sich die Grenze dieser Haltung: Ohne dass der Investor seinen Geschäftsbetrieb rentabel gestalten kann, wird auch kein Projekt realisiert. Die schöne Vision der preisgedämpften Wohnungen bleibt Vision, wenn der Eigentümer nicht bauen will oder kann.
Niedernhausen steht damit exemplarisch für ein deutsches Dilemma. Die Wohnungskrise im Rhein-Main-Raum ist strukturell und drängend. Kommunale Gestaltungsansprüche sind berechtigt und notwendig. Aber die Blockade zeigt auch: Wo die Rahmenbedingungen so starr werden, dass private Akteure rational die Hand heben, entsteht leicht Stillstand – und die Flächenkonversion von 28.500 Quadratmetern bringt der Gesellschaft keinen Wohnraum.
Szenarien für einen Ausweg
Bürgermeisterin Maier-Frutig bleibt formal gesprächsbereit: „Wenn der Eigentümer oder ein neuer Investor mit neuen Ideen kommt, kann ein neuer Aufstellungsbeschluss gefasst werden.“ Das klingt hoffnungsvoll, ist aber Politiker-Rhetorik. Die Marktlogik ist nicht außer Kraft: Heesen beklagte sich, dass „neue Ideen Geld kosten“ – und er wolle nicht noch mehr „in den Sand setzen“.
Dennoch: Der Fall bietet regionale Lernpotenziale. Erste Lehre betrifft die Kommunikation zwischen Privat und Öffentlich. Eine frühzeitige und transparente Verhandlung über die Spielregeln hätte möglicherweise zu einem anderen Ergebnis geführt. Zweite Lehre betrifft die Hessische Landesplanung und Kommunalaufsicht: Sollte es nicht Standards geben, wie Bodenwertsteigerungen zwischen privaten Akteuren und Gemeinden geteilt werden können – rechtskonform und praktikabel?
Die dritte und tiefste Lehre ist: Wenn der deutsche Sozialstaat Wohnen als Grundrecht versteht, dann können wir nicht dem Markt die Verantwortung allein überlassen. Aber auch nicht der Gemeinde. Hier bräuchte es eine Landespolitik, die Gemeinden mit Mitteln ausstattet, selbst Flächen zu akquirieren oder Modelle zu fördern, die zwischen Gemeinwohl und Rentabilität vermitteln.
Das Musicaltheater als stille Mahnung
Seit 2019 steht das Gebäude leer. Die Fassade verwittet, die Tiefgarage rostet vor sich hin. Es ist kein Baudenkmal, aber ein Menetekel: ein Symbol für die Schwierigkeit, im Rhein-Main-Raum nachhaltig und für alle bezahlbar zu bauen. Der Abriss steht „in weiter Ferne“, wie jemand der Frankfurter Allgemeinen sagte – eine Umschreibung für: vorerst nirgends geplant.
Die Chance einer Transformation liegt brach. Die Renditeerwartung ist blockiert. Das Gemeinwohl auch. Und die Baukultur? Sie verliert wieder ein Areal, das hätte zeigen können, wie man aus einer Ruine ein Quartier macht. Unter fairen Bedingungen für alle Beteiligten.

Deutschlands erste Fassade aus recyceltem Plastik entsteht im Münchner Werksviertel

Kirchlicher Immobilienverkauf: Wer übernimmt die sozialen Räume und ist die Kirchensteuer noch zeitgemäß?