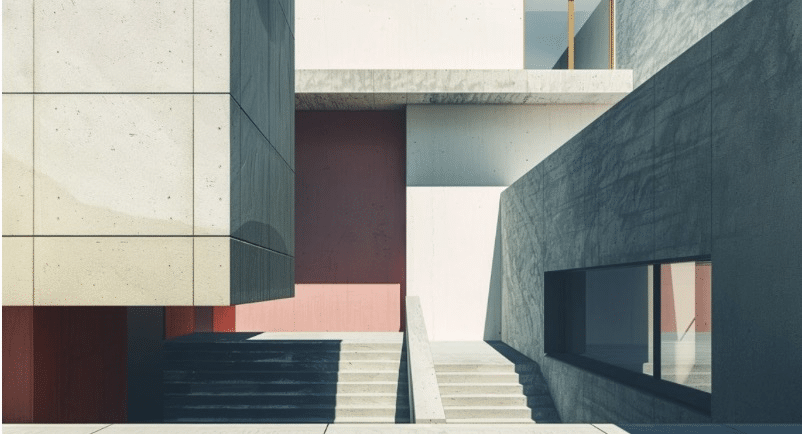Die Loos-Verheißung und ihre Verfehlungen
Adolf Loos hätte sich erschüttert abgewendet. Als der österreichische Architekt 1913 seine Regeln für das Bauen in den Bergen formulierte, leitete ihn eine unbeirrbare Überzeugung: Nicht das Bauwerk sollte malerisch wirken, sondern die Natur. Der Mensch, der sich malerisch kleidet, ist kein Kunstwerk, sondern ein Hanswurst – so Loos, und derselbe Gedanke galt für Architektur. Über ein Jahrhundert später scheint diese Botschaft nur noch eine historische Fußnote zu sein.
Heute wetteifern Architekten darin, aus den letzten unverbauten Alpengrundsätzen Instagram-Ikonen zu schaffen. Das „Hub of Huts” in Südtirol mit seinen kopfüber hängenden Satteldachhäuschen ging tausendfach um die Welt – nicht weil es eine gelungene Architektur darstellt, sondern weil sein Bild jede Scrollgeschwindigkeit durchbricht. Die „Vertical Chalets” von Peter Pichler in Kitzbühel schweben auf Holzstümpfen über die Baumwipfel. Bert am Pogusch präsentiert sich als beleuchtete zylindrische Provokation. Alle diese Projekte eint ein merkwürdiges Missverständnis: Sie halten Aufmerksamkeit für Qualität und Sichtbarkeit für Schönheit.
Die Rhetorik der Überwindung
Das Raffinierte an dieser Entwicklung ist die sprachliche Ummantelung. Architektinnen und Architekten sprechen von „Grenzensetzung”, von „Evolution der Tradition”, von „Reinterpretation”, die „zwischen Anpassung und Neuinterpretation balanciert”. Diese Formulierungen klingen nach verantwortungsvoller Reflexion. Doch wer genau hinsieht, erkennt dahinter eine systematische Strategie zur Legitimation von Spektakel.
Peter Pichler erklärt, man müsse sich der Bergwelt unterordnen – und plant doch Chalets, die in Holz-Stützgerüsten schweben. Die Architekten von DMAA versichern, mit ihrem Projekt die Landschaft nicht zu zerstören, sondern sie zu „reparieren” – während ein futuristisches Haus im Hang sich versteckt und von Ferne unsichtbar werden soll. Diese Diskrepanzen zwischen Anspruch und Realität sind nicht zweitrangig. Sie offenbaren eine grundsätzliche Heuchelei: Man nimmt die Gesinnung traditioneller Bescheidenheit in den Mund, während man die Landschaft zum Schauplatz eigener Ambition macht.
Die Global Luxury Language und die Kapitalisierung der Stille
Anita Aigner von der TU Wien hat es präzise diagnostiziert: Das alpine Bauen von heute ist an die fotografische Praxis gekoppelt. Nicht mehr die Landschaft ist das Motiv – sondern die aufmerksamkeitsheischende Architektur selbst. Die Namen dieser Projekte sind bezeichnend: „Elysion”, „Cloud P”, „Insel der Seligen”. Eine „Global Luxury Language” soll den Wunsch nach Veraußeralltäglichung anfeuern, so Weber zitierend.
Was hier passiert, ist die Umwandlung von Landschaft in Kapital – genauer: die Umwandlung von Exklusivität in Preis. Die Villa Cloud P am Faaker See hat schon seit 2021 auf Käuferinnen und Käufer. Drei Wohnungen, die kleinste für 1,97 Millionen Euro. Das ist die eigentliche Architektur dieses Zeitalters: nicht das Gebäude, sondern der Marktwert. Jedes Projekt ist eine Rendite auf Beinen. Der Berg wird zur Büroimmobilie mit Aussicht.
Nachhaltigkeitsrhetorik als grüner Anstrich
Besonders perfide ist die Nachhaltigkeitslegende, die um viele dieser Projekte gesponnen wird. Ja, es gibt Wärmepumpen, Solaranlagen, grüne Dächer. Doch die fundamentale Unsustainabilität wird dadurch nicht gelöst: die bloße Existenz des Bauwerks auf einem Grundstück, das vorher unverbaut war. Das ist nicht repariert, sondern zerstört – nur eben mit schlechtem Gewissen.
Die tatsächlich nachhaltigen Ansätze, wie Steven Downs sie in der Haute-Savoie verfolgt – passive Häuser mit 700 Euro Heizkosten pro Jahr, aus recycelten Materialien – diese Projekte erhalten nie die hundertfache mediale Aufmerksamkeit. Sie sind nicht spektakulär genug. Sie benötigen keine Instagram-Drohnenaufnahmen. Sie lassen sich nicht in drei Sekunden erfassen.
Die Gratwanderung als Ausrede
Immer wieder hört man das Wort „Gratwanderung” – zwischen Tradition und Moderne, zwischen Anpassung und Innovation. Diese Metapher ist bequem. Sie deutet an, dass es eine Mitte gibt, dass alles eine Frage der Balance ist. Doch eine Gratwanderung kann auch scheitern. Und es lohnt sich zu fragen: Wessen Gratwanderung ist es? Nicht die der Bergbauerin oder des Bergbauern, die seit Generationen mit dieser Landschaft leben. Es ist die Gratwanderung des Architekten oder der Architektin zwischen kreativer Ambition und ethischem Anspruch.
Zu oft wird diese private Gratwanderung auf dem Rücken der Allgemeinheit ausgefochten – denn die Alpenlandschaft ist kein privates Atelier. Sie gehört allen. Ihre Zerstörung ist eine Form der Aneignung.
Die Gegenbewegung und die fehlende Kritik
Es ist rätselhaft, warum die architektonische Kritik so zahnlos ist. Die Fachmagazine preisen diese Projekte in großformatigen Bildstrecken. Die Architectinnen und Architekten werden zu Stars, ihre Gebäude zu Sehenswürdigkeiten. Selten wird grundsätzlich gefragt: Darf das sein? Sollte das sein? Was verlieren wir, wenn jedes letzte Grundstück in den Bergen zum Schauplatz von Architektur-Spektakeln wird?
Es gibt gute Gegenentwürfe – nachhaltige Projekte, die respektvoll mit der Landschaft umgehen. Doch sie sind unterfinanziert, medial unsichtbar, wirtschaftlich unter Druck. Das System bevorzugt die Provokation, nicht die Demut. Es belohnt die Architektur, die sich selbst in den Mittelpunkt stellt, nicht jene, die sich unterordnet.
Was ist zu tun?
Die Forderung nach einem Baustopp in den Alpen ist unrealistisch – und möglicherweise nicht einmal wünschenswert. Die Forderung nach echtem, nicht greenwashed, nachhaltigem Bauen ist hingegen notwendig. Sie erfordert die Bereitschaft zu ehrlicher, unglamouröser Architektur. Sie erfordert auch eine Veränderung der Anreizstrukturen: nicht Projekte fördern, die fotografierbar sind, sondern jene, die nachhaltig sind. Die Kammer sollte architektonische Hybris sanktionieren, nicht sie als Boldface-Titel zelebrieren.
Vor allem aber wäre es nötig, Loos wieder zu lesen. Nicht nostalgisch, nicht als historisches Relikt, sondern als Provokation für die Gegenwart: Das Bauwerk soll nicht malerisch sein. Die Natur ist malerisch genug. Wer das verneint, handelt nicht als Architekt oder Architektin, sondern als Hanswurst.

Wie Österreich seine Denkmaler digital rettet – und real gefährdet

Die Pixellüge: Wie KI-Bilder die Architektur korrumpieren