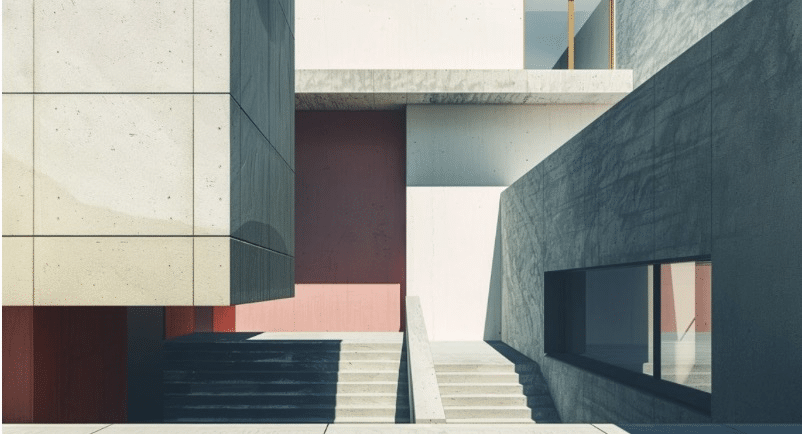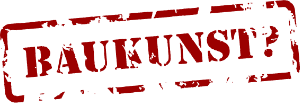Ein kritischer Blick auf die Wurzeln des deutschen Regulierungsdickichts
Der September 1970 markierte einen Wendepunkt in der deutschen Baugeschichte. An einem lauen Spätsommerabend besetzten Studentinnen und Studenten ein Jugendstilhaus in der Frankfurter Eppsteiner Straße 47. Der Investor wollte das historische Gebäude abreißen und durch ein Hochhaus ersetzen. Es war die erste Hausbesetzung in Deutschland, und sie kündigte einen fundamentalen Wandel an: Die Bürgerinnen und Bürger begannen, für mehr Mitsprache beim Bauen zu kämpfen. Ironischerweise kämpften sie damit auch für mehr Bürokratie.
Die goldenen Jahre des Bauens
Zwischen 1953 und 1968 entstanden in der Bundesrepublik jährlich über 500.000 Wohnungen. 1973 erreichte der Wohnungsbau seinen historischen Höhepunkt mit mehr als 714.000 fertiggestellten Einheiten. Ganze Stadtviertel wuchsen aus dem Boden: die Frankfurter Nordweststadt, die Berliner Gropiusstadt, die Hamburger City Nord. Die Köhlbrandbrücke in Hamburg wurde in nur vier Jahren errichtet, was damals bereits als Verzögerung galt. Der Neubau dieser Brücke soll heute bis 2046 dauern.
Der Preis dieser Geschwindigkeit war hoch. Auf Anwohnerinnen und Anwohner nahm man wenig Rücksicht. Wer nahe einer Verkehrsader oder eines Kohlekraftwerks wohnte, hatte schlicht Pech. Die „autogerechte Stadt” galt als Planungsideal. Quer durch Berliner Gründerzeitviertel zog man eine Stadtautobahn, die den Charakter ganzer Bezirke unwiderruflich veränderte. Der Rhein war, wie die FAZ 1971 schrieb, zu „Europas größter Schmutzrinne” geworden.
Die Siebziger: Geburtsstunde der Baubürokratie
Der gesellschaftliche Wandel, der mit der 68er Bewegung einsetzte, erfasste auch das Bauen. Die Bürgerinitiative gegen das Atomkraftwerk Würgassen in Ostwestfalen errang 1972 einen juristischen Meilenstein: Erstmals wurden Umweltschutzbelange als gleichwertig mit anderen Interessen anerkannt. In Berlin verhinderte die Bürgerinitiative Westtangente durch jahrelange Proteste den Bau einer weiteren Stadtautobahn.
Die Politik reagierte. Ausgerechnet der liberale Umweltminister Hans Dietrich Genscher initiierte 1971 ein „Sofortprogramm” für den Umweltschutz. Das Bundesimmissionsschutzgesetz von 1974 führte ein Konzept ein, das weitreichende Konsequenzen haben sollte: das Vorsorgeprinzip. Künftig war Regulierung auch dann gerechtfertigt, wenn noch nicht klar war, ob tatsächlich Umweltrisiken bestanden. Dem Juristen Cass Sunstein zufolge werden damit politische Maßnahmen rechtfertigbar, die mit sehr hohen Kosten verbunden sind.
1976 folgte eine Novelle des Baugesetzbuches. Erstmals wurde eine Abbruchgenehmigung eingeführt, erstmals tauchten umfangreiche Bürgerbeteiligungen im Baurecht auf. Das Ziel war der Erhalt von „Ortsbild” und „Zusammensetzung der Bevölkerung”, was sich wie eine frühe Kritik an Gentrifizierung liest. Die Soziologin Maren Harnack beschreibt den Paradigmenwechsel: Der moderne Siedlungsbau der Nachkriegszeit hatte erstmals komfortablen, gesunden und bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Nun galt er als „Fordismus im Privatleben” und wurde von einer gebildeten Mittelschicht zunehmend abgelehnt.
Die Spirale dreht sich weiter
Die Gesetzeskaskade setzte sich fort. Bundesnaturschutzgesetz, Energieeinsparungsverordnung, europäische Umweltrichtlinien. Mit der Aarhus Konvention in den Neunzigerjahren erhielten Umweltverbände das Recht zur Verbandsklage. Im Baurecht selbst habe sich gar nicht so viel geändert, erklärt Susan Grotefels vom Zentralinstitut für Raumplanung. In den Landesbauordnungen stehe nach wie vor, eine Baugenehmigung sei grundsätzlich zu erteilen, wenn nichts dagegen spreche. „Nur sprach eben mit der Zeit immer mehr dagegen, vor allem im Umweltrecht.”
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland nur noch 215.900 Wohnungen genehmigt, der niedrigste Stand seit 2010. Die durchschnittliche Bauzeit hat sich auf 26 Monate verlängert, sechs Monate mehr als noch 2020. Der Bauüberhang, also genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen, beträgt 759.700 Einheiten. Deutschlands größtes Wohnungsbauunternehmen Vonovia kritisiert: „Es gibt 16 Landesbauordnungen und 4000 Baunormen. Genehmigungsverfahren dauern zu lang. Häufig sind Prozesse noch in Papierform zu erledigen.”
Der schwierige Weg zurück
Die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag 2025 ambitionierte Ziele formuliert. Die Bürokratiekosten für die Wirtschaft sollen um 25 Prozent gesenkt werden, ein „Wohnungsbau Turbo” soll Genehmigungsverfahren beschleunigen, der neue „Gebäudetyp E” soll einfacheres Bauen ermöglichen. Das „E” steht für einfach: Dreifachverglasung, Handtuchheizkörper bei vorhandener Fußbodenheizung, die fünfte Steckdose im Wohnzimmer, all diese Komfortstandards sollen künftig vertraglich ausgeschlossen werden können.
Die Pilotprojekte in Bayern zeigen vielversprechende Ergebnisse. Das erste nach Gebäudetyp E fertiggestellte Projekt, ein „Haus fast ohne Heizung”, demonstriert, dass Qualität auch mit reduzierten Standards möglich ist. Kritiker wie der Deutsche Mieterbund warnen jedoch vor Einsparungen zulasten von Schallschutz und Wohnkomfort. Die rechtliche Bewertung bleibt umstritten.
Die Ironie der Geschichte ist kaum zu übersehen. Die Regeln, die in den Siebzigerjahren die Umwelt schützen sollten, bremsen heute die notwendigen Maßnahmen für eine nachhaltigere Wirtschaft: den Bau von Windkraftanlagen und Solarkraftwerken, von Stromtrassen zwischen den Offshore Windparks im Norden und der Industrie im Süden, von Bahnstrecken, die den Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern könnten. Eine Rückkehr in die Sechzigerjahre ist weder möglich noch wünschenswert. Die saubere Luft in deutschen Städten ist eine erhebliche Errungenschaft. Aber vielleicht, so die FAZ, würden schon „ein bisschen mehr Abwägung und Bereitschaft zum Kompromiss” für eine Bürokratiewende reichen.

Wie Österreich seine Denkmaler digital rettet – und real gefährdet

Die Pixellüge: Wie KI-Bilder die Architektur korrumpieren