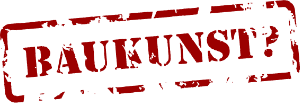Baukosten unter 2000 Euro je Quadratmeter: Der Wettstreit ist entbrannt
In der deutschsprachigen Bauwirtschaft ist ein regelrechter Wettbewerb entbrannt. Strabag, Porr und Buwog überbieten sich gegenseitig mit Ankündigungen, die Baukosten pro Quadratmeter unter die psychologisch wichtige Marke von 2000 Euro drücken zu wollen. Während am Markt derzeit Baukosten von fast 3000 Euro pro Quadratmeter üblich sind und Genossenschaften bei etwa 2500 Euro liegen, versprechen die Konzerne eine Revolution durch vorgefertigte Elemente und serielle Bauweisen.
Strabag launcht Tetriqx
Der Baukonzern Strabag hat Mitte August 2025 ein serientaugliches Wohnbauprodukt namens Tetriqx auf den Markt gebracht. Der Name erinnert nicht ganz zufällig an das beliebte Computerspiel, bei dem es darum geht, Blöcke übereinanderzuschlichten. Genau das ist das Prinzip: Ein Baukastensystem mit hohem Vorfertigungsgrad, das in einem österreichischen Werk produziert und vor Ort nur noch endmontiert wird.
Tetriqx setzt auf Holz-Hybrid-Bauweise mit CO2-reduziertem Beton und umfasst drei fertig geplante Wohnbautypen (Typ B, C und D) für unterschiedliche Bauklassen. Alle drei lassen sich auf Wohngebäude von bis zu sieben Stockwerken aufstocken und haben optimierte Grundrisse von circa 44 bis zu rund 88 Quadratmetern.
Strabag-Sprecherin Isabella Nutz berichtet von rund 40 Grundstücken bundesweit, die derzeit auf ihre Eignung für das Tetriqx-System geprüft werden. Die ersten Projekte sollen im nächsten Jahr begonnen werden. Die Bauzeit soll im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren um bis zu vier Monate reduziert werden können.
Porr kündigt noch niedrigere Kosten an
Die Baukosten pro Quadratmeter sogar deutlich unter 2000 Euro zu bringen, das hat bereits im Februar 2025 Karl-Heinz Strauss, Vorstandschef des Baukonzerns Porr, angekündigt. Auf Anfrage heißt es vonseiten der Porr AG, das Thema sei über die Konzeptionierung hinaus und man befinde sich bereits in der Umsetzung. Erste konkrete Projekte in Elementbauweise wolle man in absehbarer Zeit kommunizieren.
Interessant ist der Kontext dieser Ankündigung: Für 2025 werden in Österreich nur noch 24.600 Wohneinheiten fertiggestellt, 32 Prozent weniger als im Vorjahr. Porr-Chef Strauss spricht von einer Wohnbaukrise, nicht von einer Baukrise. Der Infrastrukturbau boomt, der Wohnungsbau lahmt. Vor allem im dritten Quartal 2025 kam es zu besonders starken Rückgängen: bei frei finanzierten Mietwohnungen um etwa 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei frei finanzierten Eigentumswohnungen um elf Prozent.
Buwog und Gropyus: Modulbau in Berlin und Salzburg
Schon etwas länger ist auch der Bauträger Buwog an der System- beziehungsweise Modulbauweise dran. Gemeinsam mit dem österreichisch-deutschen Unternehmen Gropyus sind Projekte in Berlin und Salzburg geplant. In Berlin entstehen 158 Wohnungen nach dem seriellen Prinzip.
Damit formiert sich ein Oligopol der großen Baukonzerne, das den Markt für kostengünstigen Wohnungsbau unter sich aufteilen will. Die Versprechen klingen verlockend: Produktion im Trockenen, verkürzte Bauzeit auf der Baustelle, parallelisierte Fertigung während der Bauplatzarbeiten.
Die Vorteile der Vorfertigung
Die Argumente für das serielle Bauen sind nicht von der Hand zu weisen. Die Produktion geht in der Fabrik und damit im Trockenen vonstatten. Vor Ort werden die Elemente wie bei einem Fertighaus nur noch zusammengesetzt, was die Bauzeit auf der Baustelle verkürzt. Die Fertigung kann auch bereits beginnen, wenn am Bauplatz selbst noch gearbeitet wird, was weitere Einsparungen an Zeit ermöglicht.
Die GdW-Rahmenvereinbarung Serielles und modulares Bauen 2.0 hat bereits 25 innovative Konzepte von 20 Bietern in den deutschen Markt gebracht. Der Medianwert liegt bei unter 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, die Preisspanne reicht von 2.370 bis 4.370 Euro. Die Konzepte umfassen Holzbau, Stahlbeton und Hybridbauweisen.
Der blinde Fleck der Standardisierung
Die Kritik an der Standardisierungswelle ist nicht neu, aber sie gewinnt an Dringlichkeit. Während das Bundesverteidigungsministerium ab 2027 den Bau von 270 standardisierten Kompaniegebäuden plant und das im militärischen Kontext völlig legitim ist, stellt sich im zivilen Wohnungsbau eine andere Frage: Was bleibt von den Orten, wenn überall die gleichen Module gestapelt werden?
Hessen hat mit dem Musterfeuerwehrhaus einen anderen Weg gezeigt: Musterraumprogramme und Grundrisse werden bereitgestellt, lassen sich aber an örtliche Gegebenheiten anpassen. Die Handlungsempfehlung schafft Effizienz, ohne die individuelle Verantwortung für den Ort aufzugeben.
Im Wohnungsbau hingegen droht eine andere Entwicklung. Laut Schätzungen des Zentralen Immobilien Ausschusses werden derzeit erst rund fünf Prozent der Wohnungen in Deutschland seriell oder modular errichtet. Angesichts der massiven politischen Förderung und der Offensive der großen Baukonzerne könnte sich dieser Anteil in den kommenden Jahren vervielfachen.
Das Kleingedruckte der Versprechen
Die Zahlen klingen verlockend. Doch die Wohnungswirtschaft kennt die Tücken des Kleingedruckten. Die 1.950 Euro der Strabag gelten als Baukostenpreis ohne Planung und ohne Garage, Preisstand 1. Januar 2025. Grundstück, Erschließung, Außenanlagen und Nebenkosten sind nicht eingerechnet. Für eine realistische Gesamtkalkulation müssen Bauherrinnen und Bauherren deutlich höhere Beträge einplanen.
Hinzu kommt: Serielles Bauen funktioniert nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Strabag selbst definiert als Mindestanforderung eine Grundstücksgröße von 3.000 Quadratmetern mit Widmung für mehrgeschossigen Wohnbau, ohne Hanglage, ohne Sonderfundierung und ohne übergroße Außenanlagen. In verdichteten Innenstädten, auf schwierigen Grundstücken oder bei individuellen Anforderungen stößt das System an seine Grenzen.
Die Fachkräftefrage als treibende Kraft
Hinter der Offensive für serielles Bauen steht nicht nur die Kostenfrage, sondern auch ein massiver Fachkräftemangel. Die industrielle Vorfertigung in Werkhallen ermöglicht Schichtarbeit, reduziert wetterbedingte Ausfallzeiten und macht die Baubranche attraktiver für Fachkräfte, die ungern bei Wind und Wetter auf der Baustelle stehen.
Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, bringt es auf den Punkt: Die Branche müsse künftig mit weniger Menschen mehr bauen. Die Produktivitätssteigerung durch Vorfertigung sei daher nicht nur eine ökonomische, sondern eine strategische Notwendigkeit.
Die baukulturelle Frage
Die Bundesarchitektenkammer hat in einem Positionspapier darauf hingewiesen, dass serielles und modulares Bauen kein Selbstzweck sein darf, sondern ein Mittel zur Produktivitätssteigerung. Die Frage, wann Standardisierung hilft und wann sie schadet, bleibt in der politischen Debatte oft unbeantwortet.
Was gleich aussieht, bleibt selten in Erinnerung. Standardisierte Zonen wirken austauschbar, emotionslos, identitätslos. Und wenn Heimat austauschbar wird, hört sie auf, Heimat zu sein. Die Wohnungsbauprojekte, die heute entstehen, prägen das Stadtbild der nächsten 50 Jahre.
Das Feuerwehrhaus war früher das Herz mancher Dörfer. Man plante gemeinsam, stritt über Fensterachsen, feierte Richtfest und Einweihung. Das Gebäude erzählte eine Geschichte, die Geschichte des Ortes. Standardisierung sagt: Das brauchen wir alles nicht. Es kostet zu viel Zeit.
Fazit: Differenzierung statt Dogmatik
Die 2000 Euro Grenze ist ein psychologischer Schwellenwert, der die öffentliche Debatte befeuert. Strabag hat mit Tetriqx vorgelegt, Porr will sogar noch darunter kommen, Buwog setzt mit Gropyus eigene Akzente. Der Wettbewerb ist eröffnet.
Doch der Preis allein ist kein Qualitätskriterium. Entscheidend ist, dass die Branche die Standardisierung als Werkzeug begreift, nicht als Selbstzweck. Es braucht klare Grenzen. Kasernen dürfen gleich aussehen. Provisorische Unterkünfte auch. Aber Wohnquartiere, die das Stadtbild der nächsten Jahrzehnte prägen, tragen eine doppelte Verantwortung: für die Funktion und für die Erinnerung.
Das ist nicht rückwärtsgewandt. Das ist vorwärtsgewandt und erfordert Mut. Es bedeutet, dass beim Schulbau nicht einfach abgeschrieben werden darf, nur weil die Zahlen stimmen. Es bedeutet, dass Ortskerne nicht zu Verwaltungszonen werden dürfen. Es bedeutet, dass Architektinnen und Architekten wieder befähigt werden müssen, zu entscheiden, wann die Module genommen werden und wann eigenständig gedacht wird.

Bauen für den Leerstand? Das Paradoxon der europäischen Wohnungspolitik

Wohnungsmarktbericht 2025: Warum Niedersachsen 218.000 neue Wohnungen braucht, obwohl die Bevölkerung schrumpft