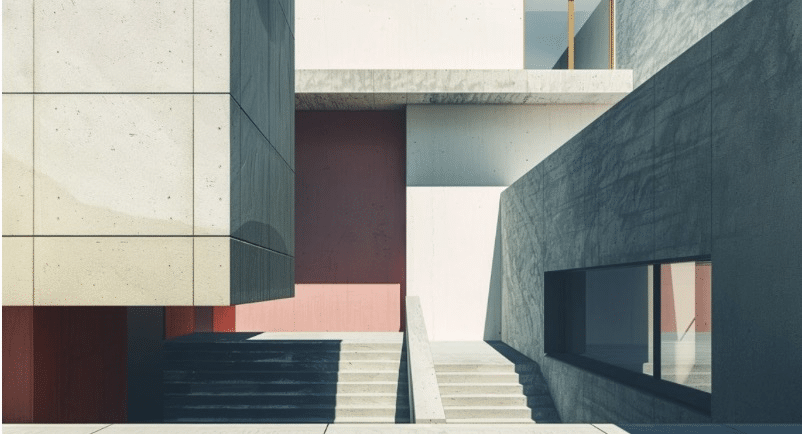Architektonische Bestandssensibilität am Beispiel des Stralsunder Meeresmuseums
Respekt vor der Schichtenvielfalt
Wer Stralsund bereist, kommt um das Katharinenkloster nicht herum. Seine gotische Basilika mit den charakteristischen Spitzbogenfenstern prägt seit 1280 das Bild der Hansestadt. Seit 1951 beherbergt sie das Deutsche Meeresmuseum, eine Institution, die längst über ihre Grenzen hinaus strahlt – nicht zuletzt wegen ihrer besonderen Lage mitten im UNESCO-Welterbe. Doch was macht diesen Ort wirklich besonders, ist nicht allein die Historie, sondern die Art, wie Epochen hier schichtweise zusammengefügt wurden. Der Umbau durch Reichel Schlaier Architekten aus Stuttgart offenbart es: Architektur ist manchmal weniger Hinzufügung als vielmehr kluges Lesen dessen, was bereits vorhanden ist.
Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten drei Jahrzehnten als Kulturstandort an der Ostsee neu erfunden. Das Meeresmuseum steht exemplarisch für diese Strategie – eine Institution, die Wissenschaft, Tourismus und regionale Identität miteinander verwebt. Mit vier Standorten bespielt das Museum heute die Altstadt; das Stammhaus im Katharinenkloster bleibt allerdings das Herzstück. Hier manifestiert sich buchstäblich, was regionale Bautradition bedeutet: eine Schichttorte aus Mittelalter, 19. Jahrhundert, DDR-Pragmatismus und Nachwendeoptimismus.
Das Mero-Fachwerk als Zeugnis der Modernitätsfieber
Der entscheidende Moment kam 1972–1974. Damals führten Planerinnen und Planer der älteren Generation die industrielle Moderne ins gotische Kirchenschiff ein. Sie wählten das Mero-Raumfachwerk-System – eine westdeutsche Stahlkonstruktion, die in ihrer Zeit als innovativ, sogar revolutionär galt. Zwei neue Ebenen entstanden, um dem Museum seinen neuen Zweck zu geben. Was damals als mutige Geste galt, sah später aus wie eine gewisse Beengtheit. Dennoch: Das Ensemble stand zurecht unter Denkmalschutz, denn es verkörperte etwas Authentisches – den Mut der Nachkriegsmoderne, sich des Alten anzunehmen.
Reichel und Schlaier hatten hier bereits Erfahrung. Beide hatten beim Büro Behnisch den Bau des Ozeaneums (2002–2008) verantwortet – eine glänzend inszenierte, zeitgenössische Attraktion direkt am Hafen. Dass sie nun für das Stammhaus den Zuschlag erhielten, war für sie eine Überraschung und eine Heimkehr zugleich. Die Aufgabe lautete unscheinbar: Bestand ertüchtigen, Barrierefreiheit verbessern, ein großes Aquarium errichten. Doch wer zwischen Gotik, Industriebau und denkmalpflegerischen Restriktionen navigieren muss, weiß: Subtilität ist gefragt.
Das Forum als Katalysator
Die Architekten setzten an einer Stelle an, die von Anfang an Probleme bereitete: dem Eingangsbereich. Eine alte Turnhalle aus dem 19. Jahrhundert wurde zur Keimzelle einer großzügigen Eingangshalle umgestaltet – ein Forum im klassischen Sinne, das Kasse, Garderobe und Orientierung bietet. Der Trick liegt in der Zurückhaltung: Weiß lackierte Stahlkonstruktion vor Backsteinfassade, oben durchbrochene Oberlichter, die den Blick zum Hauptportal der Kirche freigeben. Das ist keine bombastische Geste, sondern Gebrauchsarchitektur mit Feingefühl.
Besonders bemerkenswert ist die Behandlung des kleinen Westhofs, jenes verschlossenen Hofraums, der für Außenstehende lange unsichtbar war. Durch die Überbauung wird er zum zentralen Erschließungsraum. Der neue Bodenebelag – alte Granitplatten, die das Museum jahrzehntelang hortet – schafft eine sanfte Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Höhenniveaus. Das ist praktische Barrierefreiheit ohne Rampenideologie: pragmatisch, elegant, nachhaltig im besten Sinne.
Das Kirchenschiff: Zurückbau als Akt der Klarheit
Im Kirchenschiff selbst offenbaren sich Reichels und Schlaiers Design-Prinzipien besonders deutlich. Der alte Bodenbelag bleibt. Das Mero-Fachwerk wurde gereinigt, einige Abschnitte der obersten Ebene aber gezielt zurückgebaut – ein seltenes architektonisches Verfahren, das Mut erfordert. Der Raum atmet nun wieder, die gotischen Proportionen werden erlebbar. Neue Brüstungen aus dunklen U-Profilen und Klarglas ersetzen die alten Drahtglaskonstruktionen – nicht nur sicherer, sondern auch transparenter. Es ist die unaufgeregte Materialisierung der späten Moderne, eine respektvolle Hommage an jene 1970er-Jahre-Planerinnen und -Planer, deren Mut damals genauso notwendig war wie die Korrekturen heute.
Ein Detail verdient besondere Aufmerksamkeit: der Chor-Boden. Er lag zwei Stufen über dem Hauptschiff – eine historische Anomalie, die die Architekten zurückbauten. Unter dem Bodenbelag kamen Fundamente zum Vorschein, die vor 1282 entstanden – möglicherweise das älteste bauliche Zeugnis Stralsunds. Hier offenbart sich, was verantwortungsvolle Sanierung bedeutet: nicht konservierend erstarren, sondern die Archäologie der Zeit offenlegen.
Das Große Aquarium: Spektakel im Untergrund
Die neueste Attraktion braucht keine architektonische Inszenierung. Das Große Aquarium mit seinen karibischen Fischen hinter einer 50 Zentimeter dicken Acrylglasscheibe ist Spektakel genug. Die Architekten verstanden, dass hier der Inhalt die Form prägt – und ordneten sich dem unter. Dennoch: Die neue Acryl-Schale sitzt in einem Gebäude, das außen mit handwerklich gefertigten Kupferblechen verkleidet ist. Die Neubauteile sind damit klar lesbar, suchen aber über Material und Farbigkeit den Anschluss an die hanseatische Bautradition.
In den historischen Kellergewölben überrascht ein besonderes Relikt: Leni Schamals Keramiktafel „Schau in die Welt” aus dem Jahr 1984. Sie zeigt Gesichter, die über eine Mauer lugen – ein unmissverständliches DDR-Artefakt. Die Architekten ließen dieses Zeugnis stehen, erinnern sich damit an die eigene, hundert Jahre umfassende Geschichte des Hauses. Das ist kritisches Erinnern ohne Nostalgie.
Regionale Bedeutung und Lehre
Was Stralsund und sein Meeresmuseum für andere Regionen bedeutsam macht, liegt im Umgang mit Widersprüchen. Mecklenburg-Vorpommern kämpft mit Herausforderungen, die viele ländliche Bundesländer teilen: Bevölkerungsrückgang, Fachkräftemangel, die Spannung zwischen Tourismusentwicklung und Bewahrung. Der alte Hansestadt-Gürtel, das Welterbe, die starke kulturelle Infrastruktur – das sind Ressourcen, die nur dann nachhaltig wirken, wenn Baukultur ernst genommen wird.
Direktor Andreas Tanschus, gebürtiger Stralsunder und seit 1991 am Museum in verschiedenen Positionen tätig, spielte eine maßgebliche Rolle. Ohne solche kontinuierlich engagierten Akteure vor Ort funktioniert Architekturqualität nicht. Die 51 Millionen Euro Baukosten sind im regionalen Kontext erheblich. Dass trotz begrenzterer Mittel als in Metropolregionen ein qualitatives Projekt entstand, verdankt sich einer unaufgeregten Kooperationsbereitschaft zwischen Bauherrschaft, Denkmalamt, Architekten und Handwerk.
Ausblick
Reichel und Schlaier haben ein Projekt vollendet, das Wille und Augenmaß widerspiegelt – und das deshalb in einer Zeit der Kosmetik-Sanierungen so erfrischend wirkt. Sie zeigen: Mut zur Kritik am Bestand, zur Reduktion, zum Zurückbau kann Hand in Hand gehen mit Respekt vor der Geschichte. Das Meeresmuseum ist kein Denkmal-Kult-Projekt, sondern ein lebender Organismus, der sich selbst neu erzählt.
Für Planerinnen und Planer bundesweit, insbesondere in strukturschwachen Regionen, könnte die Stralsunder Lektüre wertvoll sein. Nicht alles muss neu sein. Manchmal ist das Wichtigste, die richtigen Fragen zu stellen – und den Mut zu haben, Antworten zu akzeptieren, die unspektakulär wirken.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Adresse und Kontakt
Deutsches Meeresmuseum – Meeresmuseum (Stammhaus) Katharinenberg 14–20 18439 Stralsund, Deutschland
Telefon: +49 (0)3831 2650-610 Fax: +49 (0)3831 2650-609 Website: www.deutsches-meeresmuseum.de
Öffnungszeiten
Ganzjährig:
- September bis Juni: täglich 9:30–17:00 Uhr
- Juli bis August: täglich 9:30–19:00 Uhr
-
- Dezember: geschlossen
-
- Dezember: 9:30–15:00 Uhr
- Kassenschluss: 60 Minuten vor Schließung
Weitere Standorte der Stiftung Deutsches Meeresmuseum
Das Museum betreibt zusätzliche Standorte in der Region:
- OZEANEUM (Hafeninsel): Hafenstraße 11–13
- NATUREUM Darßer Ort (Nationalpark): Am Darßer Ort 1
- NAUTINEUM (Sammlungsstandort, Dänholm): Für Forschung und Archivbestände

Wie Österreich seine Denkmaler digital rettet – und real gefährdet

Die Pixellüge: Wie KI-Bilder die Architektur korrumpieren